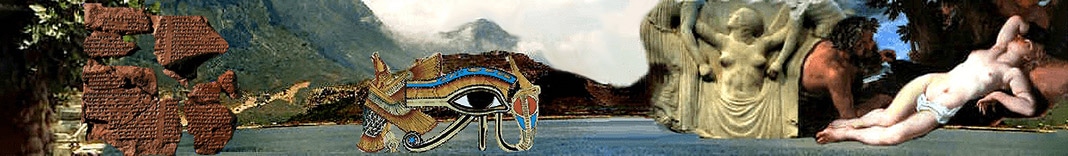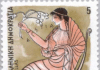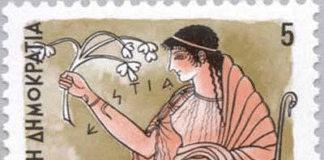Das Mittelalter in Europa ist schon eine Weile her, trotzdem wirkt es auf viele Menschen überaus interessant. Man datiert es heute ungefähr von 500 bis 1500 nach Christus. Mit der Entdeckung Amerikas, so der aktuelle Forschungsstand, endete die mittelalterliche Epoche. Nicht selten ist auch vom dunklen Mittelalter die Rede, doch das ist, wie eigentlich immer, eine Frage der Perspektive. An welche Götter glaubten die Menschen im Mittelalter und wie veränderte sich ihr Glaube im Laufe dieser rund 1000 Jahre?
Wie lebten die Menschen im Mittelalter?

In der heutigen Zeit haben wir kaum eine Vorstellung davon, wie das Mittelalter gewesen sein muss. Es gibt zwar verschiedene Quellen, die Einblicke bieten, doch das Leben und die Sorgen sowie Ängste, die die Menschen gehabt haben, lassen sich kaum nachvollziehen. In Büchern und Filmen werden viele Lebensweisen romantisch dargestellt.
Auch auf Mittelaltermärkten, auf denen Gruppen zusammenkommen, mittelalterliche Schuhe und Kleidung tragen und sich an Ritterspielen vergnügen, lässt kaum einen realistischen Eindruck vom wahren Leben im Mittelalter zu. Schauen wir also etwas genauer hin.
Die Ständegesellschaft im Mittelalter

Ganz anders als heute hatte jeder Mensch von Geburt an einen festen Platz in der Gesellschaft. Kaiser, Adel, Ritter und Bauern, wobei es viele Bauern und nur einen Kaiser gab. Dazwischen, außerhalb dieser vier Stände, gab es die geistliche Hierarchie, vom Papst über die Bischöfe und Priester bis zu den Mönchen und Nonnen.
Und dann gab es auch schon den Narren, dem wohl schon damals die berühmte „Narrenfreiheit“ eingeräumt wurde. Till Eulenspiegel ist hierzulande wohl die bekannteste Figur, weshalb Till Reiners in einem seiner jüngsten Podcasts mit Moritz Neumeier (Stand April 2025) seinen Eltern dankbar für diesen Namen ist.
Wie dunkel oder wie hoffnungsvoll das Mittelalter „tatsächlich“ war, war regional und zeitlich (1000 Jahre!) sicherlich sehr verschieden. Zudem sah für einen Adligen die Welt, in der er lebte, vermutlich sehr viel heller aus als für einen bettelarmen Bauern.
Doch seit dem 12. Jahrhundert etwa begannen sich an vielen Flussläufen und Furten Städte zu entwickeln. Dies waren Orte, an denen intensiver Handel getrieben wurde. Und mit den immer mächtiger werdenden Händlern und Stadt-Bürgern kündigte sich schon das Ende des Mittelalters an.
Pest: Ein Drittel der Menschen raffte sie dahin
Das Gesundheitswesen basierte auf Naturheilmethoden, was im kleinen, überschaubar lokalen Umfeld erstaunlich gut funktioniert haben soll. Hildegard von Bingen, eine deutsche Äbtissin, schrieb zum Beispiel im 11. Jahrhundert eine direkt anwendbare Kräuterkunde nieder. Dem Ansturm der schwarzen Pest aber waren die Naturheilmethoden des Mittelalters nicht gewachsen. Um 1350 grassierte die Pest an die sieben Jahre lang in ganz Europa. 25 Millionen Menschen fielen dieser Pest zum Opfer – ein Drittel der damals auf dem Kontinent lebenden Bevölkerung.
Und besser als wir waren die Menschen auch damals nicht darin, sich diese plötzlich über sie hereinbrechende Katastrophe zu erklären. Auch mit Schuldzuweisungen sollen sie, den Überlieferungen nach, schnell bei der Hand gewesen sein. Solange sie die Pest denn überlebten. Ein Drittel der Bevölkerung – das sind noch mal ganz andere Dimensionen als heutzutage.
Götter im frühen Mittelalter

Je nachdem, wie man die historischen Ereignisse ordnet, könnte man sagen, dass das Mittelalter nach dem Zerfall des Römischen Reiches entstand. Die Zeit nach dem Zerfall des Römischen Reiches wäre dann das frühe Mittelalter.
Im frühen Mittelalter verehrten die Menschen daher noch nicht nur einen Gott, sondern zunächst verschiedene germanische oder keltische Gottheiten. Zu den germanischen Göttern zählen Balder, Donar, Folla oder Freyja. Auch der keltische Glaube war in weiten Teilen Europas verbreitet. Von den keltischen Göttern ist vielleicht der sagenumwobene, gehörnte Cernunnos der bekannteste Gott.
Diese und viele andere Götter waren nach dem Glauben der Menschen im Mittelalter die ewige Quelle des Lebens auf der Erde und die Natur. Die Wikinger wie auch die Germanen waren tief überzeugt davon, dass die Götter die Naturkräfte beherrschten. Man könnte auch sagen, dass die Götter sämtliche Naturkräfte und deren Zusammenspiel waren.
Der Glaube an verschiedene Götter und deren Zusammenspiel gab den Menschen im Mittelalter Sicherheit. Warum? Durch Rituale und andere ausgefeilte Zeremonien schien es möglich, die Götter und damit eben die Naturkräfte zu beeinflussen.
Und da Regen und Wind, Hitze und Erde auf einem komplexen Zusammenspiel vieler Kräfte beruhen, wird es mit Sicherheit auch vorgekommen sein, dass die Menschen mit ihren Ritualen Erfolg hatten. Nicht immer, aber doch mehr als im statistischen Mittel. Sonst hätten sich diese Praktiken nicht entwickeln können – übrigens überall auf der Erde.
Die Menschen beobachteten die Kräfte der Natur sehr genau. Ihr Überleben hing davon ab. Machtlos allerdings wurden ihre Methoden, als offensichtlich wurde, dass sie nur lokal begrenzt wirkten.
Ein Gott – im späten Mittelalter
Gegen Ende des Mittelalters war vor allem der christliche Glaube stark verbreitet. Die Ständegesellschaft glaubte nunmehr an einen Gott und kaum an verschiedene Götter oder Naturgeister. Das hatte den Hintergrund, dass die Kirche immer größeren Einfluss auf die Menschen hatte.
Im Laufe des Mittelalters wuchs die christliche Gemeinde zusehends. Das lag daran, dass die Kirche infolge der Kreuzzüge immer größeren Einfluss auf die Menschen hatte. Gleichzeitig wurde durch die Staatskirche der Glauben an heidnische Kulte verboten. Fortan glaubten die meisten Menschen an Gott, der als Schöpfer von Himmel und Erde verantwortlich ist.
Ebenso waren sie der Ansicht, dass Gott in das irdische Leben eingreifen kann und Krankheiten als Strafe nutzt. Durch die Einhaltung der Gebote und das Führen eines moralischen Lebens, so glaubten die Menschen im späten Mittelalter, war ihnen nach dem Tod ein Leben im Himmel und somit ein ewiges Leben möglich.
Menschen, die sich nicht an die Glaubenssätze der christlichen Kirche hielten, rückten in den Fokus. Vor allem Menschen, die sich kaum mit der Kirche beschäftigten, weiterhin ein heidnisches Leben pflegten und sich mit anderen Göttern befassten, wurden als Ketzer betrachtet.
Es kam zur bischöflichen Inquisition, bei der alle Bischöfe verpflichtet wurden, Ketzer und somit Nichtgläubige aufzuspüren und zu verurteilen. Menschen, die sich weiterhin eng mit der Natur verbunden fühlten und ihre eigenen Glaubenswahrheiten oder Lehrmeinungen vertraten, wurden verfolgt, gefoltert und nicht selten mit dem Tode bestraft.
Quellen:
- Text: Pest im Späten Mittelalter / Cernunnos / Leben im Mittelalter / Talk ohne Gast
- Bilder: © Cernunnos: CC BY-SA 3.0, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=192624 / Depositphotos / Depositphotos / Depositphotos